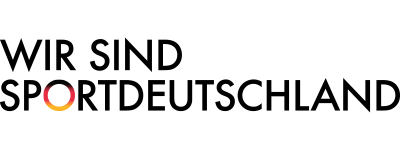Böse Frage zu Beginn. Wenn sie an den FC Bundestag denken, was ist ihr erster Gedanke: Demokratie, Freizeitmannschaft, AfD?
Tuğba Tekkal: Für mich ist es erst mal der Gedanke, dass ganz unterschiedliche Parteien unter dem Mantel des Fußballs zusammenkommen, alle ihre politischen Kämpfe beiseitelegen. Das finde ich persönlich sehr schön. Auch gegen sie zu spielen und ihnen mal zu zeigen, wie es richtig geht, freut mich sehr. (lacht)
Otto Addo: Das sehe ich auch so, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen im Sport und eine gemeinsame Basis finden, sich auf sportliche Art und Weise miteinander messen können. Fußball kann ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein.
Gerade erst hat der FC Bundestag beschlossen, die AfD nicht mehr mitspielen zu lassen.
Tekkal: Ich wäre sonst nicht zu dem Spiel gekommen. Es wäre nicht mit meinen Werten vereinbar gewesen. Und wenn man sich anschaut, worum es bei den Recherchen von „Correctiv“ zum AfD-Treffen in Potsdam im vergangenen Jahr gegangen ist, dann muss man sagen: um Otto Addo und mich, dass sie Menschen wie uns nicht zugehörig sehen in diesem Land.
Addo: Ich komme sehr gern zu einem Termin wie diesen, wenn man weiß, dass man willkommen ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, warum sollte ich dann dort hingehen?
Was bringen solche Termine wie das Spiel gegen den FC Bundestag?
Tekkal: Ich merke das eigentlich täglich bei meinem Projekt „Scoring Girls“; es geht um die Macht der persönlichen Begegnung, den Austausch. Ich bin ein Fan der persönlichen Begegnung, dass man zusammenkommt, in diesem Fall eben auf dem Fußballplatz, gemeinsam für eine Sache und den Erfolg brennt.
Ist es auch wichtig, den kurzen Weg zur Politik zu haben?
Tekkal: Unbedingt. Wir können natürlich auf die Straße gehen, wir können fordern, dass wir es so oder so haben möchten. Aber letztlich geht es darum, im Detail darüber zu sprechen, was passiert und was verändert werden muss, damit sich Menschen in diesem Land zugehörig fühlen. Dafür sind solche Treffen wichtig.
Addo: Man muss die Probleme ansprechen, es liegt so viel im Argen. Ich bekomme so viele Anrufe, in denen es auch um Rassismus im Sport geht. Diese Themen müssen mit den Politiker*innen am besten persönlich besprochen werden.
Rassismus und Diskriminierungen scheinen nie zu enden. Haben Sie das gleiche Gefühl wie vor 20 Jahren? In der vielbeachteten Dokumentation „Schwarze Adler“ beschreiben Sie es so, Herr Addo.
Addo: Für mich stellt sich Frage: Können wir noch mehr tun, um gegen den Rassismus anzugehen? Wie können wir Menschen aus dem Sport in die Diskussion einbeziehen? Wie kann man Opfern helfen? Wie kann man Täter in ihre Schranken weisen, um das Leben aller die Sport treiben, besser zu machen? Und unsere Rolle ist auch, der Politik Erfahrung aus erster Hand zu vermitteln.
Tekkal: Ich empfinde es so wie Otto Addo. Es hat sich nicht viel geändert. Das sehe ich tagtäglich bei den Mädchen in meinen Projekten, die vor denselben Herausforderungen stehen, wie ich vor 20 Jahren. Die Frage ist: was ist eigentlich schiefgelaufen? Warum trauen sich Leute draußen mittlerweile mehr zu sagen als vor 20 Jahren. Und was ist mit der integrativen Kraft des Sports, die ich genau so erlebt habe.
Fühlen Sie sich genügend unterstützt oder ein eher missbraucht als Aushängeschilder gegen Rassismus?
Addo: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Dass ich als Vater von elf und zwölfjährigen Söhnen erleben muss, wie meine Kinder auf Fußballplätzen beleidigt werden und die Schiedsrichter nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ist besorgniserregend. Da gibt es viel zu tun, auch im Zusammenspiel mit dem DFB.
Tekkal: Wir sind keine Menschen, die sagen, alles ist blöd, aber ich kann den Schmerz Otto Addos in Bezug auf seine Kinder sehr gut nachvollziehen. Es geht um den guten Willen, die Gesprächsbereitschaft, darum, mit den Leuten in den Dialog zu treten. Eine andere Chance haben wir gar nicht, auch wenn es anstrengend ist.
Macht sich die Aufsplittung der Gesellschaft negativ bemerkbar?
Tekkal: Wir erleben tagtäglich bei unserer Arbeit, dass die Menschen eine Seite wählen und dass es wichtig ist, auf welcher Seite man selbst stehst. Die Grautöne sind verschwunden. Da hats ich tatsächlich sehr negativ entwickelt. Insgesamt ist die Arbeit als Menschenrechtsaktivistin schwieriger geworden. Mit jungen Leuten zu reden wird wichtiger vor dem Hintergrund von Social Media - und anstrengender. Die haben viele Ängste und Sorgen, aber auch krasse Meinungen. Wir müssen verhindern, dass eine Wut bei den Jugendlichen entsteht, aus dem Gefühl heraus, sie gehörten nicht zur Gesellschaft. In dieser Zurückweisung sind sie dann empfänglich für die Propaganda der Islamisten oder der AfD.
Ihr Projekt „Háwar Help“, Frau Tekkal, ist auch vor dem Hintergrund des Mordes des sogenannten Islamischen Staates im Irak an den Jesiden ab 2014 entstanden? Was macht das mit Ihnen, wenn wie jüngst in Hamburg fürs Kalifat in Deutschland demonstriert wird.
Tekkal: Als wir die Bilder gesehen haben, meine Geschwister und ich, dachten wir, das seien Bilder aus Rakka oder Mossul. Unter diesen Schlachtrufen haben sie die jesidischen Frauen vergewaltigt und Kinder zu Soldaten gemacht. Junge Männer enthauptet. Wir haben zwar keine Angst, aber warnen seit langem. Meine Schwester Duzen hat schon vor acht Jahren ein Buch geschrieben, für das sich niemand interessiert hat und indem es genau um diese Thematik ging („Deutschland ist bedroht: Warum wir unsere Werte jetzt verteidigen müssen“, Berlin Verlag 2016, Anm. d. Redaktion). Doch was für mich mindestens genauso wichtig ist: Derjenige, der die Demonstration in Hamburg initiiert hat, ist ein angehender Lehrer. Offensichtlich schützt also auch Bildung nicht vor Extremismus.
Glauben Sie, dass die Warnung in der Politik angekommen ist?
Tekkal: Ich weiß es nicht. Wichtig ist aber, dass wir klar trennen: Es gibt die Islamisten, die extremistischen, und es gibt die Muslime, die einer stärker werdenden Islamfeindlichkeit ausgesetzt sind.
Addo: Die Medien spielen eine ganz entscheidende Rolle, denn sie müssen klar unterscheiden, was da passiert und dürfen nicht alle und alles einen Topf schmeißen. Den Medien muss bewusst sein, dass bestimmte Nachrichten auch bestimmte Bilder in den Köpfen der Menschen manifestieren. Medien haben eine große Verantwortung. Auch darüber müssen wir reden.
Sind wir an einem Scheidepunkt in Bezug auf dieses Einwanderungsgesellschaft?
Tekkal: Ich hoffe, dass unsere Generation es schafft, dass sich alle zugehörig fühlen, und zwar unabhängig von der Leistung. Als wir kleiner waren, hat meine Mutter immer gesagt: Wenn 100 Prozent nicht reichen, dann gebt 200 Prozent. Das wurde uns Kindern eingetrichtert. Und meine Geschwister und ich funktionieren immer noch so, um irgendwie dazugehören. Das ist so eine Überanpassung. Aber das ist unfair, wir müssen davon wegkommen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu sagen, hey, du gehörst nur dazu, wenn du 200 Prozent gibst. Deine 100 Prozent reichen nicht. Wie kann es sein, dass wir jemanden auf seine Herkunft reduzieren, sobald er nicht gut genug ist?
Hoffen Sie auf ein zweites Sommermärchen?
Tekkal: Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal WM 2006 haben möchte, denn ich sehe eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz als damals. Die Mannschaft macht mir Hoffnung, sie macht mir Spaß, weil sie mit ihren unterschiedlichen Herkünften auch Deutschland widerspiegelt. Ich bin euphorisch, ich freu mich auf dieses Turnier im eigenen Land. Ich sehe das als Chance, wenn man es richtig macht und wenn wir natürlich erfolgreich sind (lacht).
Was verbinden Sie damit, Otto Addo?
Ich bin gespannt, auch wenn es vielleicht nicht so läuft wie weit die Gesellschaft ist. Das wenn es läuft, dann spielt es keine Rolle. Integration tritt dann in den Hintergrund. Es ist ganz wichtig, dass man im Vorfeld schon klarmacht, dass es nicht darum geht, dass Menschen mit Zuwanderung froh sein dürfen, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, dass sie Teil der Gesellschaft sind.
Wie ist ihr Tipp?
Tekkal: Finale, auf jeden Fall! (lacht)
Addo: Oh, das ist echt schwer. Aber ich sage mal, dass Deutschland die Gruppenphase übersteht und mindestens ins Halbfinale kommt. (lacht)
(Interview: Marcus Meyer/ Quelle: DOSB)
Otto Addo, geboren 1975 in Hamburg, wuchs als Sohn einer ghanaischen medizinischen Assistentin in Hamburg auf. Mit acht Jahren begann er mit dem Fußballspielen, 1999 feierte er bei Borussia Dortmund seinen Bundesligaeinstand, wurde 2002 mit den Schwarzgelben Deutscher Meister. Für die ghanaische Nationalmannschaft lief Otto Addo insgesamt 15 Mal auf, auch zur WM 2006 in Deutschland. Zuletzt war er als einer der Co-Trainer von Edin Terzić in Dortmund tätig. Seit März 2024 ist Addo ghanaischer Nationaltrainer. Der 48-Jährige setzt sich seit Jahren gegen Rassismus im und außerhalb des Sports ein.
Tuğba Tekkal ist das siebte von elf Kindern einer jesidischen Familie, aufgewachsen in Hannover. Gespielt hat die mittlerweile 39-Jährige unter anderem für den HSV und den 1. FC Köln, ehe sie sich als Sozialunternehmerin der Förderung von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte zuwandte. Ihrer Menschenrechtsorganisation Háwar.help e.V., die sie zusammen mit ihren Schwestern betreibt, dem Empowerment-Projekt „Scoring-Girls“ und die Bildungsinitiative „GermanDream“, gilt ihr ganzes Engagement.